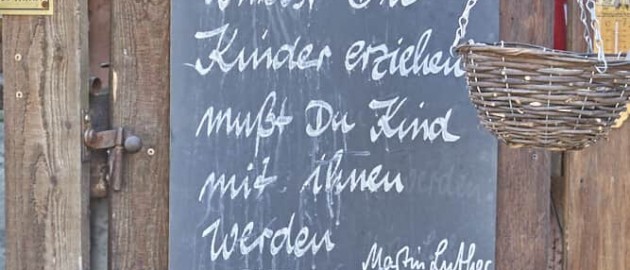Vater und Sohn
Sein Vater starb mit Mitte fünfzig. Jünger, als nun er jetzt ist. Aber er hat ihm nichts vorzuwerfen, nichts zu verzeihen. Der Sohn dem Vater. Weil er versucht zu verstehen.
Vater war Alkoholiker. Keine Feier ohne Bier und Schnaps. Das gehörte dazu. Um lustig zu sein. Spaß zu haben. Indessen macht er vieles nicht so, wie sein Vater. Er trinkt nie zu viel. Zwar mal ein Glas Bier im Sommer, an einem warmen Tag. Auch mal Abends ein Glas Rotwein. Aber nie mehr. Denn er braucht das nicht. Um lustig zu sein. Oder die Augen zu verschließen. Dahingegen sein Vater brauchte es.
Um zu vergessen: Den schrecklichen Krieg. In dem er als junger Mann, als Kind, eingezogen worden war. Die Wunden der Verletzung. Aber manchmal schmerzte ihn der amputierte Arm. Phantomschmerzen nannte er es. Ein Arm war verloren. Jedoch nicht nur ein Arm. Sondern ein Stück von der Seele. Ein Teil von der Möglichkeit, sich einzufühlen. Weil Gewalt zum Überleben überlebenswichtig war. Und weil ihn Kriegsgewalt abgestumpft hatte.
Ein Junge weint nicht. Du willst doch ein Mann werden. Waren Vaters Worte, wenn dem Sohn, als kleines Kind, die Tränen kamen. Im Lauf der Jahre wurde der Rücken krumm. Sitz doch gerade, herrschte ihn der Vater immer wieder an. Aber es half nicht. Vater konnte mit Befehlen nicht die Last nehmen, die sich mit der Zeit auf den Schultern des Sohnes anhäufte.
Sein Sohn litt unter seinen unberechenbaren Gewaltausbrüchen. Aber er machte sie sich nicht zu eigen. Auch wenn er den Jähzorn nachvollziehen kann. Der in einem entstehen kann. In Situationen, in den man sich absolut nicht wohl fühlt. In denen man gezwungen ist zu sein. Ohne sich dabei gut zu fühlen. In denen man nicht sich selbst leben kann. Sich verliert. In denen man dann, voller unkontrollierter Wut, nicht mehr nachdenken kann. Mehr als überfordert. Was, wenn nicht ein erlebter Krieg, ist eine solche Situation? Vater hatte es nie gelernt, sich aus solchen Situationen zu befreien. Er konnte es nie. Er durfte es nie. Auch wenn er es versuchte. Vielleicht.
Sein Vater, der gerne unterwegs war. Auf der Suche? Der einen Familiensinn hatte. Und doch war seine eigene Familie, nur nach außen hin, heile. Der Verlust seiner Heimat. Die Weite der Kurischen Nehrung an der Ostsee. Aber mehr noch das verloren gegangene Gut in Ostpreußen. Vielleicht waren das die Wurzeln seiner Sehnsucht. Sich zu befreien. Die ihn umtrieb. Unausgesprochen. Auf seinen Wanderungen. Auf seinen Reisen.
Vater machte gerne lange Spaziergänge. Manchmal begleitet von seinem Sohn. Der mitgehen musste. Meistens wortlos. Den Gedanken nachhängend. Mit einem Vater. Dem der Sohn nicht vertrauen konnte. Nie. Weil seine Gewalt, seine Person, Furcht ausstrahlte. Und eine, von einem Kind nicht greifbare, verwirrende Widersprüchlichkeit im Leben. Und nie das Gefühl, das eine Sicherheit vermittelt, sich auf etwas, und sei es ein Wort, verlassen zu können. Nicht vergessen zu sein. Sich wirklich verlassen zu können. Gerechtigkeit, Vertrauen, Verantwortung, Zärtlichkeit, Liebe. Tiefe Werte. Die sein Vater ihm nur dadurch vermitteln konnte, in dem er sie ihm gegenüber nicht vermittelte. Dadurch, dass sie fehlten.
Der Sohn kann dem Kreislauf entkommen. Dem sich über Familiengenerationen immer wieder wiederholenden Schicksal aus Gewalt und Sucht. Er kann sagen, nein, ich mach’s nicht so wie mein Vater. Ich probiere erst gar nicht aus, was er mir vorlebte. Vater rauchte. Alles stank nach abgestandenen Rauch. Sein Raucherhusten hörte man im ganzen Haus. Und genau deswegen rauchte der Sohn nie auch nur eine Zigarette, probierte es nie.
Aber alles hat seinen Preis. Denn der Vater lies ihn alleine. Er war nicht da. Als Vater. Dieses Gefühl, des allein gelassen seins, lässt ihn nie los.
Als Vater starb, war er 15. Beide verbrachten zusammen einige Tage an der Ostsee. Vater und Sohn. Vater, gezeichnet von den Folgen seiner Sucht. Parkinson. Schütteltrauma. Deshalb konnte nicht mehr allein zur Kur, an das ersehnte Meer. Beide machten kleine Spaziergänge. Redeten nicht viel. Aber waren sich doch irgendwie nahe. Er fühlte sich nicht unwohl, mit seinem Vater. Der nicht unglücklich schien. Eher ausgeglichen. Vielleicht lag das am Meer. Der endlosen Weite.
Am Nachmittag unternahmen sie eine Butterfahrt. Mit dem Schiff. Wieder zurück, es regnete stark. Deswegen gingen beide schnellen Schrittes zum Quartier. Zu schnell.
In einer Einkaufspassage brach der Vater zusammen und starb.
Irgendwelche Menschen regelten alles. Am nächsten Tag fuhr der Sohn mit, im schwarzen Leichenwagen, in die Heimatstadt. Schweigend. Alleingelassen. Nicht nur vom Vater.
Aber der Sohn hatte ihn nicht allein gelassen.